So gibst du Angehörigen narzisstischer Menschen Hilfe & Halt

Narzisstische Personen können in privaten wie beruflichen Beziehungen tiefgreifendes Leid verursachen. Während die betroffenen Personen selbst häufig keine Krankheitseinsicht zeigen, suchen ihre Partner:innen, Kinder oder Kolleg:innen Hilfe in der Therapie. Mit gezielter Begleitung kannst Du ihnen bereits in wenigen Sitzungen Entlastung ermöglichen und neue Handlungsspielräume eröffnen.
„Der ist so ein Narzisst!“ – ein Satz, den Du vermutlich schon von Patient:innen gehört hast oder aus deinem Freundes- und Kolleg:innenkreis kennst. Im Alltag wird der Begriff häufig vorschnell auf Menschen angewendet, die als überheblich, dominant oder egozentrisch wahrgenommen werden. Dabei ist Narzissmus kein feststehendes Etikett, sondern bewegt sich auf einem Spektrum zwischen gesunder Selbstachtung und krankhafter Persönlichkeitsstörung. Nicht jede kränkbare oder selbstbezogene Person erfüllt die Kriterien einer narzisstischen Störung. Und nicht jede konflikthafte Beziehung lässt sich auf eine narzisstische Dynamik reduzieren. Aber: Ab einem gewissen Punkt werden narzisstische Eigenschaften tatsächlich zum Problem – vor allem für das Umfeld.
Narzissmus – Zwischen Selbstwert und Selbstüberschätzung
Ein gewisses Maß an narzisstischem Verhalten ist normal – und psychisch gesund. Wir alle streben nach Anerkennung, Erfolg und Wertschätzung. Ein gesunder Narzissmus stabilisiert das Selbstwertgefühl, hilft uns, Ziele zu verfolgen und für uns einzustehen. Problematisch wird es, wenn dieses Streben in Größenfantasien, extreme Kränkbarkeit, Empathiemangel und einen instrumentellen Umgang mit anderen, etwa durch Manipulation oder Ausnutzung zur Erreichung eigener Ziele, kippt – und das Ich nachhaltig so sehr in den Vordergrund tritt, dass für das Du kaum noch Raum bleibt. Narzisstische Personen neigen zu unrealistischen Idealen von Erfolg, Macht oder Attraktivität, die im Kontrast zu einem innerlich fragilen Selbstwert stehen. Narzissmus lässt sich mit dem Blutdruck vergleichen: Ein gewisses Maß ist notwendig, ein Zuviel jedoch schädlich. Während sich Bluthochdruck klar messen lässt, verläuft die Grenze beim Narzissmus fließend und wird oft erst dann erkannt, wenn Mitmenschen darunter leiden (vgl. Lammers, 2024, S. 8).
Um die Diagnose stellen zu können, muss nicht nur das Umfeld, sondern die betreffende Person selbst unter den Folgen ihres Narzissmus leiden. Schon im ICD‑10 war die narzisstische Persönlichkeitsstörung keine eigenständige Diagnose, sondern unter F60.8 „Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen“ aufgeführt – ohne eigene diagnostische Kriterien. Im ICD‑11 wurde dieses kategoriale System durch ein dimensionales Modell ersetzt. Die Diagnose erfolgt nun auf Basis des Schweregrads der Persönlichkeitsstörung und ausgeprägter Merkmalsbereiche (sog. Trait-Domänen). Merkmale narzisstischer Persönlichkeitsausprägung lassen sich v. a. unter der Domäne „Dissozialität“ einordnen.
Wenn Nähe verletzt: Narzisstische Dynamiken belasten Beziehungen
Diese Merkmale führen im Alltag zu belastenden Beziehungsmustern, besonders in engen Bindungen. Menschen mit starken narzisstischen Anteilen leben in einem paradoxen Beziehungsdilemma: Sie brauchen Nähe und Bewunderung – sind aber nicht fähig, sich wirklich auf andere einzulassen. Für Angehörige bedeutet das oft: emotionale Kälte, Abwertung, Schuldumkehr, übermäßige Kontrolle oder Isolation sowie häufig auch Gewalt in finanzieller, psychischer, sexualisierter und /oder körperlicher Form. In den meisten Fällen sind es alleine die Angehörigen – Partner:innen, Kinder, Kolleg:innen –, die Hilfe suchen. Sie brauchen eine individualisierte psychotherapeutische Begleitung, die sowohl stabilisiert als auch befähigt, klarer mit der belastenden Dynamik umzugehen, die sie häufig in schädlichen Mustern gefangen hält und ihre psychische Gesundheit stark beeinträchtigen kann.
Klarheit, Halt und Handlungsperspektiven
Dabei geht es weniger um die Veränderung der narzisstischen Person als um die Stärkung der Betroffenen selbst. Schon etwa 5-10 Sitzungen zeigen oft große Wirkung (vgl. Lammers, 2024, S. 60). Folgende Aspekte können Entlastung schaffen und neue Handlungsperspektiven eröffnen:
1. Klarheit über die Beziehung gewinnen
Viele Angehörige stehen vor der Frage: Soll ich bleiben oder gehen? Deine Aufgabe ist es, keine Entscheidung vorwegzunehmen, sondern den Entscheidungsprozess zu begleiten – durch Reflexion, emotionale Entlastung und Abwägen von Risiken und Ressourcen. In der Psychoedukation kannst du durch folgende Impulse entlasten und erste Erkenntnisse gewinnen:
- Normalisierung & Validierung (z. B. „Es ist nachvollziehbar, dass Sie sich belastet fühlen – viele Menschen in vergleichbaren Beziehungen berichten Ähnliches.“, Oder: „Wenn Nähe dauerhaft mit Kritik, Abwertung oder Kontrolle verbunden ist, hinterlässt das Spuren – bei jedem Menschen.“)
- Wie zeigt sich pathologischer Narzissmus? Könnte ein solcher bei der betreffenden Person vorliegen? Hat die narzisstische Person selbst Änderungsmotivation oder sogar Bereitschaft, psychotherapeutische Unterstützung zu suchen? Ist das Hoffen auf Veränderung und Lösen der Beziehungsproblematik realistisch?
2. Destruktive Kommunikationsmuster erkennen und verändern
Typisch für narzisstische Beziehungen sind Eskalationen und Schuldzuweisungen. Ein häufiger Irrtum: Konfrontation bringt Einsicht. Das Gegenteil ist oft der Fall. Narzisstische Personen reagieren auf Kritik meist mit Abwehr, Aggression, Kränkung oder Rückzug. Im therapeutischen Setting kannst Du gemeinsam mit Angehörigen daran arbeiten, typische Eskalationsmuster zu durchbrechen. Claas-Hinrich Lammers (2024, S. 60) empfiehlt u. a. folgende bewährte kommunikative Strategien:
- Ich-Botschaften statt Vorwürfe (z. B. „Ich fühle mich überfordert und eingeschüchtert, wenn du in diesem Ton mit mir sprichst.“)
- Konkrete Beispiele statt pauschaler Kritik (z. B. „Gestern Abend hast du mir kaum zugehört und nur von deinem Tag erzählt – das hat mich traurig gemacht.“)
- Rationalität statt Emotionalisierung (z. B. „Ich schlage vor, dass wir beide erst mal durchatmen und dann gemeinsam schauen, wie wir das Problem lösen können.“)
- Fokussierung auf gemeinsame Ziele (z. B. „Uns beiden ist wichtig, dass die Kinder nicht unter unseren Konflikten leiden – lass uns einen Weg finden, das besser hinzubekommen.“)
Positives Verhalten anerkennen (z. B. „Ich habe mich gefreut, dass du mich gestern gefragt hast, wie mein Tag war – das hat mir gutgetan.“)

3. Selbstfürsorge stärken
In narzisstischen Beziehungen verlieren Angehörige oft den Bezug zu sich selbst. Sie sind damit beschäftigt, Konflikte zu vermeiden, Erwartungen zu erfüllen oder sich gegen (subtile) Angriffe zu wehren. Du kannst helfen, den Fokus wieder auf eigene Bedürfnisse, Ressourcen und Werte zu lenken: Was gibt mir Energie? Was brauche ich, um mich zu schützen? Wie kann ich Nein sagen, ohne Schuldgefühle zu haben?
4. Grenzen setzen und schützen
Bei destruktivem Verhalten ist eine ruhige, aber bestimmte Grenzziehung entscheidend. Klare, ruhige Aussagen wie „Wenn du wieder laut wirst oder mich abwertest, werde ich das Gespräch beenden“ oder „Ich bin bereit zu reden – aber nicht unter diesen Bedingungen“ können erste Schritte in Richtung Selbstbehauptung sein (vgl. Lammers, 2024, S. 60). Doch nicht jede Grenze lässt sich sicher kommunizieren – insbesondere dann nicht, wenn die Gefahr besteht, dass eine Grenzsetzung aggressiv beantwortet wird. Du solltest als Therapeut:in in solchen Situationen nicht nur psychosozial stabilisieren, sondern auch konkret auf Hilfsangebote verweisen und gegebenenfalls mit spezialisierten Stellen zusammenarbeiten. Dazu zählen etwa:
- das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 116 016
- das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“: 0800 1239900
- sowie lokale Frauenhäuser, Männerberatungsstellen oder Opferschutzstellen.
- Bei akutem Risiko: Polizei (110) oder Krisendienste.
5. Soziale Unterstützung aktivieren – Isolation durchbrechen
Angehörige von Menschen mit narzisstischen Zügen sind häufig emotional und sozial isoliert. Viele wurden über Jahre hinweg kontrolliert oder entmutigt, Kontakte zu halten und offen über ihre Beziehung zu sprechen – aus Angst vor Ablehnung, Schuldgefühlen oder gezielter Abwertung durch die narzisstische Person. Ein wichtiger Teil der therapeutischen Begleitung ist die Reaktivierung sozialer Ressourcen. Du kannst ermutigen, wieder Kontakt zu wohlwollenden Menschen aufzunehmen oder neue Bindungen aufzubauen – etwa über Selbsthilfegruppen, Beratungsangebote oder Online-Communities. Ein stabiles soziales Netz bietet nicht nur emotionale Entlastung: Es stärkt die Selbstwirksamkeit und macht Veränderungen oft überhaupt erst möglich.
Drei Strategien im Umgang mit narzisstischen Personen
In der therapeutischen Begleitung von Angehörigen ist es hilfreich, folgende Grundoptionen zu besprechen (vgl. Lammers, 2024, S. 58 ff.):
1. Ertragen – bewusst und aktiv: Bleibt die narzisstische Person uneinsichtig und die Beziehung soll dennoch aufrechterhalten werden (z. B. wegen gemeinsamer Kinder oder beruflicher Abhängigkeiten), kann ein bewusster Umgang mit dem Ertragen hilfreich sein. Ziel: emotionale Distanz statt Dauerfrust.
2. Verändern – in der eigenen Haltung: Oft gibt es keine Veränderung der narzisstischen Person – aber Spielraum für Veränderungen im eigenen Verhalten. Statt zu kämpfen oder zu hoffen, können Angehörige lernen, sich selbst zu regulieren, Erwartungen zu reduzieren und destruktive Dynamiken zu durchbrechen (s. oben).
3. Trennen – als Akt der Selbstachtung: Wenn die Beziehung dauerhaft schadet, kann eine Trennung bzw. Kündigung notwendig sein. Du kannst helfen, diesen Schritt zu ermöglichen: emotional zu stabilisieren, praktische Fragen zu klären und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Wichtig: Trennungen müssen – insbesondere bei narzisstisch geprägten Partner:innen mit kontrollierendem oder gewalttätigem Verhalten – sorgfältig vorbereitet und sicher umgesetzt werden. In solchen Konstellationen kann bereits das Aussprechen eines Trennungswunsches zur Eskalation führen – im Extremfall kann für Betroffene sogar akute Lebensgefahr entstehen. Hier ist besondere Umsicht gefragt: Neben der Vermittlung von Unterstützungsangeboten und Schutzmaßnahmen sind Stabilisierung und eine behutsame Aufarbeitung möglicher Traumatisierungen zentrale Elemente der Begleitung.
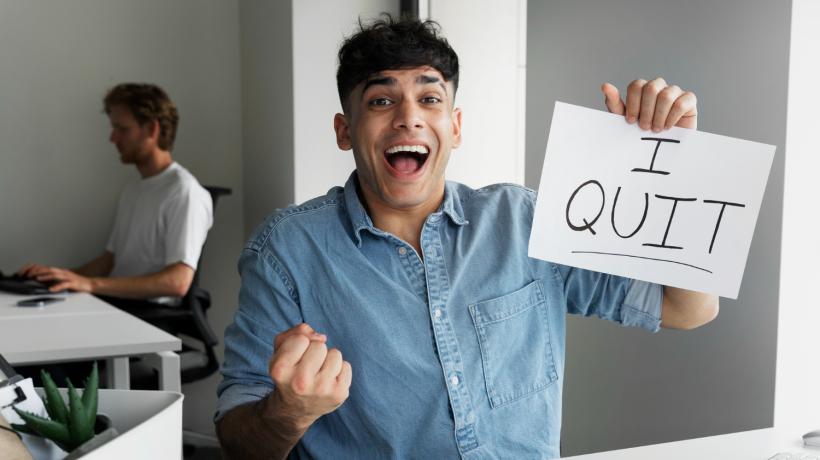
Psychotherapeutische Haltung: klar, wertschätzend, ressourcenorientiert
Die Arbeit mit Angehörigen narzisstischer Menschen verlangt dabei eine klare therapeutische Haltung. Es geht nicht darum, Diagnosen für Abwesende zu stellen oder Schuldzuweisungen zu bestätigen. Sondern darum, den Blick auf die psychische Gesundheit und Handlungsspielräume der Patient:innen zu richten. Du kannst als Therapeut:in einen enorm wichtigen Beitrag leisten – durch gezielte, individualisierte Unterstützung, durch Vermittlung von Wissen, Reflexionshilfe und konkrete Strategien zur Selbststärkung. Denn wenn Nähe verletzt, brauchen Angehörige Halt. Und dieser Halt beginnt oft in Deinem Therapieraum.
Du möchtest Deinen Patient:innen einen Ratgeber an die Hand geben? Oder dich selbst weiter über das Thema informieren?
[Werbung] „Ratgeber Narzissmus. Informationen für Betroffene und Angehörige“ von Claas-Hinrich Lammers (2024) ist beim Hogrefe Verlag erschienen und für 9,95 Euro erhältlich. Mehr Informationen findest du hier.

