Mit unkonventionellen Methoden die Psychotherapie bereichern

Martin Rauh-Köpsel ist tiefenpsychologisch-fundierter Psychotherapeut, Psychodramatherapeut, Berater für Film und TV, Professor für „Psychologie und Dramaturgie“ und Buchautor. Im Interview erzählt er von seinem facettenreichen Werdegang und warum unkonventionelle und kreative Methoden in der Therapie oft am wirksamsten sind.
Sie haben einen sehr interessanten Werdegang. Was waren für Sie die wichtigsten Schritte und wie kam es dazu?
Nach meinem Abitur bin ich hin- und hergependelt zwischen meinen beiden Leidenschaften, Kunst und Psychologie. Ich habe mich aber dann für die Psychologie entschieden. Trotzdem bin ich der Kunst immer treu geblieben, z. B. in meiner bilderreichen Sprache. Mein tiefenpsychologisch-orientiertes Studium habe ich in Köln gemacht und gleichzeitig meine erste Ausbildung als Psychodramatiker begonnen. Das war insofern ganz lustig, als eine Kommilitonin das Psychodrama vorgestellt hat und ich mir dabei dachte: „Das ist das Letzte, was ich jemals machen werde.“ Und eine Woche später habe ich mich dann angemeldet. Das ist etwas, das sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht: Ich gehe immer den Weg der Angst. Da wo die Angst ist, gehen wir meistens nicht hin. Aber wenn man die eigene Persönlichkeit entfalten will, muss man genau dort hingehen, wo man sich nicht heimisch fühlt. Und es hat sich für mich bewährt.
Meine Psychodrama-Ausbilderin machte mich dann schon vor Ablauf meiner Ausbildung selbst zum Ausbilder. Anschließend absolvierte ich eine tiefenpsychologische Psychotherapieausbildung, arbeitete in mehreren Kliniken und daneben als Supervisor u. a. bei verschiedenen sozialen Trägern.
Dann habe ich jemanden vom Film kennengelernt und dem fiel auf, dass ich komplizierte psychologische Sachverhalte unheimlich gut runterbrechen und plausibel erklären kann. Der hat mich als Berater für Film und TV entdeckt und gesagt „dich brauchen wir“. Einige Jahre später kam der Rektor der Filmhochschule Potsdam Babelsberg zum selben Schluss und so wurde ich dort Professor für „Psychologie und Dramaturgie“.
Die letzte Etappe meiner bisherigen Karriere ist es nun, Bücher zu schreiben. Eine Menge, aber es erzählt auch viel von mir – ich liebe die Vielfalt.

Wie genau funktioniert Psychodrama und was mögen Sie an der Methode?
Nur kurz vorweg: Ich arbeite normalerweise tiefenpsychologisch. Das Psychodrama nutze ich häufig, aber eher flankierend.
Eigentlich nutzt man das Psychodrama in der Gruppentherapie, aber es funktioniert auch als Einzelmethode. Das Interessante daran ist, dass man nicht darüber redet oder sich vorstellt, was einen belastet, sondern diese Dinge mit den Klient*innen inszeniert. Ein Beispiel: Ein Klient hofft seit Jahren, eine Gehaltserhöhung vom Chef zu erhalten. Auf meine Frage, ob er nicht nachgefragt oder die Gehaltserhöhung eingefordert habe, kommt die Antwort: „Nein, immer wenn ich sowas von Autoritäten einfordere, werde ich ganz klein und stammle herum, wie damals als Junge angesichts meines autoritären Vaters.“ Beim Psychodrama würde ich das nun auf die Bühne bringen, indem ich mal den Chef spiele, der sich eine Gehaltsforderung anhört, oder ich spiele den Protagonisten und er schlüpft in die Rolle des Chefs. Es ist etwas ganz anderes, ob ich eine belastende Szene, die ich mir nicht zutraue, mal übe und durchspiele.
Man kann Psychodrama aber auch tiefenpsychologisch anwenden. In dem Fall würde man nach dem ersten Akt im Hier und Jetzt einen zweiten Psychodramaakt in der Kindheit inszenieren. Dort konfrontiert man den Klienten als erwachsene Person mit dem autoritären Vater. So kann er den Vater in seine Grenzen weisen und ihm sagen: „Verschwinde, du hast mich schon in der Kindheit klein gemacht. Ich verlasse dich hier, denn ich will ein souverän auftretender Mann werden.“ Im dritten Akt kämen wir wieder in die Gehaltsverhandlungswelt zurück und man glaubt es nicht, aber nach so einer Begehung in die Kindheit sind die Klient*innen bereinigt und gestärkt und können die Szene, die im ersten Akt noch so schwer war, plötzlich viel besser bewältigen.
Über Psychodrama werden Dinge bewusst, ich kann verschiedene Perspektiven einnehmen, kann nachhorchen, wie ich als Chef reagieren würde, wenn jemand, der ein höheres Gehalt haben will, vor mir plötzlich einknickt. Ich habe also viele Formen von Feedbacks in verschiedenen Rollen und kann mir mein eigenes Problem mal jenseits der Betroffenheitszone von außen ansehen. Das sind alles Dinge bei denen das Psychodrama weit über das Reden hinausgeht, rein ins Erleben.
In den Sitzungen mit Ihren Patient*innen nutzen Sie darüber hinaus gern sehr unkonventionelle und kreative Methoden – wie kommen Sie auf die Ideen und wann greifen Sie darauf zurück?
Ich denke sehr bilderreich und ich behaupte, dass auch die Psyche eine Bildersprache besitzt. Wenn Klient*innen mir eine Metapher anbieten, z. B.: „Die Wut ist wie ein widerspenstiger, ungehaltener Hund, den ich mit mir rumschleppe“, dann greife ich das auf und biete ihnen an, das mal durchzuspielen. Manche Patient*innen haben auch schon so viele Therapien hinter sich, dass man sie mit Deutungen nicht mehr irritieren oder aus dem Widerstand rausholen kann. Deshalb lasse ich solche Klient*innen manchmal 10 Minuten auf einem Bein stehen. Anschließend befrage ich die schmerzgeplagten Personen noch einmal nach ihrem psychischen Schmerz. Dann knickt der Widerstand oft ein und sie können davon berichten. Oder ich gebe ihnen eine Matroschka. Mit Hilfe der Puppe sollen sie dann verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit beschreiben: Wie sie nach außen wirken, welche Anteile ihrer Persönlichkeit sie nur mit Freund*innen teilen usw. Bis hin zum kleinen ungesehenen und evtl. sogar verlorenen Kind (kleinste Figur der Matroschka). Mit Hilfe dieser Übung trauen sich viele Patient*innen plötzlich, tiefere Schichten ihrer Persönlichkeit zu offenbaren.

Können Sie uns noch ein ganz konkretes Fallbeispiel beschreiben?
Ich hatte einen sehr besonderen und auch ausgesprochen lustigen Fall. In der psychosomatischen Klinik, in der ich damals arbeitete, hat sich eine Patientin der Psychotherapie verweigert. Da ich aber einen Abschlussbericht über sie schreiben musste, stimmte sie schließlich zu, wenigstens für eine einzige Sitzung zu mir zu kommen. Auf die Frage, warum sie in der Klinik sei, erzählte sie mir, dass sie häufig Depressionen habe, die sich auch somatisch niederschlagen. Sie berichtete mir, dass sie vor drei Jahren einen tollen Mann geheiratet habe, der aber ausgesprochen humorlos sei und häufig sauer werde, wenn sie Schabernack trieb. Sie hingegen lebe aber regelrecht vom Humor. Die Tatsache, dass sie nun schon seit drei Jahren ihren Humor abgelegt hatte, löste bei ihr Depressionen aus.
Ich hatte nun also nur eine Stunde, darum fragte ich die Frau: „Ist der Humor tot, oder hat er sich nur versteckt?“ Nach kurzer Überlegung sagte sie: „Den gibt es noch irgendwo, der hat sich nur versteckt.“ Daraufhin bat ich sie, zu überlegen, wo im Therapieraum er denn sein könnte, wenn er sich dort versteckt hat. Da lachte sie schon das erste Mal und sagte: „Da oben auf Ihrem Kleiderschrank.“ Ich schlug ihr dann vor, dass wir ihn gemeinsam wiederentdecken könnten, es aber nicht leicht werden würde. Sie war dazu bereit. Und dann sind wir durch den ganzen Raum über sämtliche Möbel geklettert: über ihren Therapiestuhl, den Tisch, meinen Stuhl und über eine Kommode. Dann habe ich ihr per Räuberleiter geholfen auf den Kleiderschrank zu klettern. Oben angekommen hat sie nur noch gelacht. Also am Ende stimmte es: der Humor war wirklich dort oben. Und zumindest für eine Stunde hatte sie ihn wiedergefunden.
Wie reagieren Ihre Patient*innen in der Regel, wenn Sie so etwas vorschlagen?
Grundsätzlich sind alle erstmal überrascht. Das ist aber auch gut, denn so öffnen sie sich. Manche sind dann sehr neugierig, andere eher ängstlich-zögerlich. Es ist sehr wichtig, dass man als Therapeut*in dann nicht ambivalent ist, sonst steigen viele Patient*innen gleich wieder aus. Aber natürlich entscheiden die Klient*innen, ob sie sich einlassen oder nicht. Ich stülpe niemandem etwas über. Am Ende sind eigentlich immer alle begeistert, auch ob ihres eigenen Mutes und darüber, dass sie vorangekommen sind. Denn ich verwende solche Methoden meist, wenn absehbar ist, dass man anders nicht vorankommt.
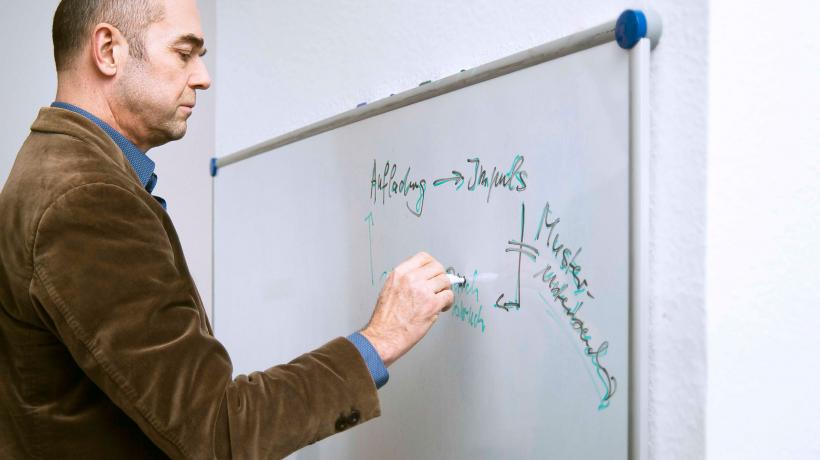
Es klingt so, als ob Sie mit Ihrem Repertoire für jede psychotherapeutische Situation gewappnet sind. Gibt es trotzdem Fälle, bei denen Sie an Ihre Grenzen gelangen? Wie gehen Sie dann vor?
Auch ich komme trotz der vielfältigen Methoden, auf die ich zurückgreifen kann, immer mal wieder an meine Grenzen, gar keine Frage. Manche Klient*innen befinden sich auch tatsächlich in ausweglosen Lagen, da kann ich auch nur begleiten und trösten.
Und es gibt eben auch ein Klientel, die bringt fast jede*n Psychotherapeut*in an die Grenzen, nämlich Personen vom „delegierenden“ Typus. Sie machen einen selbst wütend, ohnmächtig oder versetzen in Sorge. Diese Patient*innen suchen in ihrer ohnmächtigen Lage Entlastung darin, immer nur „ja aber“ zu sagen, wenn man Ideen einbringt. Am Ende ist man als Psychotherapeut*in selbst noch ohnmächtiger als der*die Patient*in. Manchen kann man mit der Gegenübertragungsdeutung noch helfen, aber bei anderen klappt auch das nicht. Da habe ich auch kein Rezept mehr.
„Ein Leben zu gestalten, ist ähnlich wie das Drehen eines Films: […] Du bist verantwortlich für deinen Film!“
Sie sind neben der Psychotherapie auch Professor an der Filmuniversität Babelsberg und Fachberater für TV und Film. Wie beeinflussen sich Ihre Arbeitsbereiche gegenseitig?
Ich finde die Frage insbesondere im Hinblick darauf spannend, wie die Psychotherapie vom Filmwesen profitiert. Mir ist in der Therapie häufiger aufgefallen, dass viele meiner Klient*innen dramaturgische Probleme haben. Ihr Leben ist zu langweilig oder sie haben Fehler gemacht. Ein Leben zu gestalten, ist ähnlich wie das Drehen eines Filmes. Am Ende des Lebens spielen wir unseren Film noch einmal ab. Einige Klient*innen stellen dann fest, dass es gar nicht ihr Leben war, dass sie immer nur anderen gehorcht oder Schauspieler*innen für ihren Film gewählt haben, die sie gar nicht wollten. Wenn man Filme macht, muss man dramaturgisch denken und das tun meine Klient*innen oft viel zu wenig. Wir sind dafür verantwortlich, die Drehbücher zu gestalten, auszuwählen, wer die Hauptrolle spielen soll, selbst den Regieplatz einzunehmen und ihn nicht anderen zu überlassen. Zu überlegen, ob das ein lustiges Leben werden soll oder eine Tragödie etc. Diese Metapher hilft ungemein, die Klient*innen wachzurütteln und ihnen begreiflich zu machen: „Du bist verantwortlich für deinen Film!“

Was raten Sie unseren Leser*innen, wenn diese nun auch Lust bekommen haben, mehr kreative Methoden in ihren Arbeitsalltag zu integrieren?
Die Tatsache, dass sich die meisten Psychotherapeut*innen in der Ausbildung für klassische Methoden bzw. Richtlinienverfahren entscheiden, bedeutet leider irgendwo den Untergang der anderen humanistischen Therapien. Aber die sind eben auch spannend: Gestalttherapie, Bioenergetik, Transaktionsanalyse usw. Ich würde den Leser*innen raten, sich mit diesen untergehenden Methoden zu beschäftigen, die ganz großartig sind. Sie enthalten viele Anregungen für kreative Vorgehensweisen in der Psychotherapie.
Weitere Anregungen für kreative Methoden in der Psychotherapie:
Rauh-Köpsel, M. (2021). Sie müssen da nicht allein durch! Aus der Praxis eines Psychotherapeuten oder warum unkonventionelle Methoden oft die wirksamsten sind. Berlin: Eden Books.




