Praxisportrait: Miki Kandale
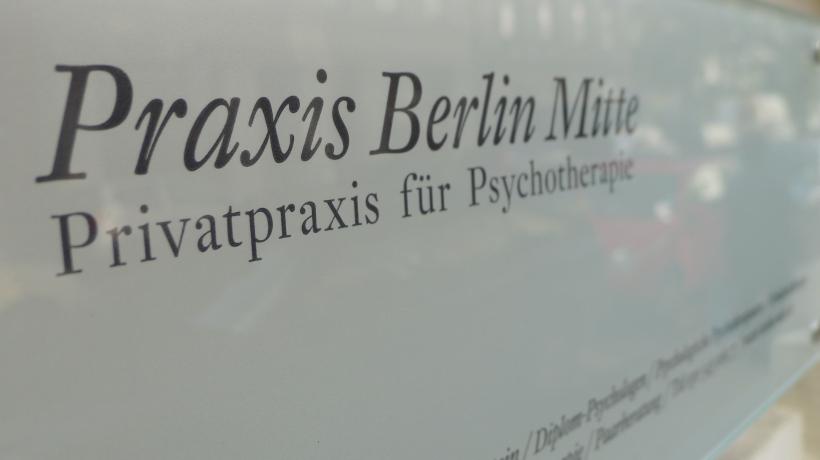
Wir besuchten Miki Kandale in ihrer psychotherapeutischen Praxis in Berlin Mitte. In den behaglichen und hellen Räumen ihrer Praxis sprachen wir über das Leben und Arbeiten in der Stadt, den Blick über den therapeutischen Tellerrand, Patient-Therapeut-Beziehungen, Kaffee und die schönen Momente des Berufsalltags.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen: Wow, eine psychotherapeutische Praxis mitten in Berlin ist mein Traum. Ist es so, dass Berlin Ihre Traumstadt ist?
Da fragen sie die Falsche: Ich bin gebürtige Berlinerin, war immer hier und will hier nicht mehr weg. Also ohne wirklich den Vergleich zu haben, würde ich sagen: Berlin ist meine Traumstadt.
Denken Sie, dass sich die psychotherapeutische Arbeit mitten in der Hauptstadt von der in anderen Städten bzw. auf dem Land unterscheidet?
Ich habe selbst keinen unmittelbaren Vergleich, aber ja, ich gehe davon aus, dass sich das unterscheidet. Es gibt ja schon Unterschiede innerhalb von Berlin: Ich habe eine Weile in Marzahn gearbeitet – mit einer zum Teil ganz anderen Klientel als hier in Mitte.
Der Verhaltenstherapie liegt ein biopsychosoziales Krankheitsverständnis zugrunde. Sicher kann man das nicht pauschal sagen, aber ich habe den Eindruck, dass es in Berlin in bestimmten Stadtteilen eher soziale Faktoren sind, die das psychische Geschehen modulieren, und in anderen Stadtteilen hat man damit nicht so viel zu tun. Vergessen dürfen wir zudem nicht, dass die Versorgungslage in kleineren Städten, auf dem Land und eben auch in den Außenbezirken von Berlin deutlich schlechter ist. Das macht auch etwas aus.
Ich behandele keine Erkrankungen, ich behandele Menschen.
Mit welchen psychischen Erkrankungen arbeiten Sie am häufigsten?
Ich behandele keine Erkrankungen, ich behandele Menschen. Menschen, die unter vielfältigsten Problemen leiden, welche natürlich krankheitswertig sind. Mein Eindruck ist, dass ich sehr viele Menschen behandele, die chronisch gestresst sind und permanent überfordert – mit Gedanken wie: „Ich muss den richtigen Beruf ergreifen, die richtige Frau finden und zum richtigen Zeitpunkt eine Familie gründen und die Kinder dann auch noch richtig erziehen. Ich muss die richtige Wohnung haben mit den richtigen Sesseln, und dann muss ich auch noch meine Freizeit richtig sinnvoll gestalten.“ Da beobachte ich eine Art Optimierungswahn und mein Eindruck ist: Je nach persönlicher Lerngeschichte und dem individuellen Cocktail aus Risikofaktoren und Ressourcen entstehen, wenn der Stress zu groß wird, ganz unterschiedliche psychophysiologische Reaktionen, die dann in einem Fall eher Depressionen begünstigen, in einem anderen eher Ängste oder Süchte.
Es gibt spannende Forschungen im Bereich der Neuro-Urbanistik, bei denen genau das untersucht wird. Leben in der Großstadt ist verdammt herausfordernd: Urbane Stressoren haben einen immensen Einfluss auf die psychische Gesundheit. So ist etwa in der Stadt insbesondere die soziale Isolation ein großes Thema. Ich weiß ja nicht, wie Sie wohnen – aber wann haben Sie das letzte Mal eine Suppe gekocht und spontan bei den Nachbar:innen geklingelt, um sie zum Mitessen einzuladen?
Viele Menschen erlebe ich als sozial isoliert und einsam, obwohl sie über vielfältigste Beziehungen verfügen.
Oder auch nur Nachbar:innen gesehen.
Oder das. Viele Menschen erlebe ich als sozial isoliert und einsam, obwohl sie über vielfältigste Beziehungen verfügen.

Sie arbeiten mit einem integrativen Therapiemodell. Was genau ist darunter zu verstehen?
Zunächst geht es für mich dabei um eine innere Haltung, darum, offen zu sein für alle Therapieschulen und -verfahren und diese als Inspiration und Bereicherung für die eigene Arbeit zu erleben. Als ich meinen Praxispartner Kai Rugenstein während der Ausbildung kennenlernte, da habe ich gemerkt, dass wir ein ähnliches Menschenbild und Verständnis von Psychotherapie teilen: So vielfältig psychische Störungen sind, so vielfältig sind die Wege zu deren Linderung. Nun werden wir in Deutschland oft lediglich in einem Therapieverfahren sozialisiert, und ich denke, es ist richtig, sich in diesem erst einmal gut auszukennen und zum Experten zu werden. Doch gute Psychotherapie braucht kollegialen, fachlichen Austausch, auch über die Grenzen des eigenen Verfahrens hinweg. Mein Kollege und ich haben nach den Jahren, die wir zusammenarbeiten, immer noch Aha-Momente durch den Blick und die Expertise des anderen.
Oft schreiben Patient:innen nicht einen von uns direkt an, dann schauen wir: Welche:r Patient:in mit welchem Anliegen benötigt welche Hilfe? Wenn es zeitlich einzurichten ist, geben wir zum Beispiel Betroffenen die Möglichkeit, zwei Erstgespräche zu erleben – mit einer Verhaltenstherapeutin und einem Tiefenpsychologen. Manchmal hat es sich so ergeben, dass ein:e Patient:in zunächst eine tiefenpsychologische Psychotherapie gemacht und dann eine Verhaltenstherapie angeschlossen hat, um die gesammelten Erkenntnisse in seinem/ihrem Leben umsetzen zu können.
Sind das die Gründe dafür, dass Sie sich für eine Gemeinschaftspraxis mit einem Tiefenpsychologen entschieden haben?
Im Nachhinein denke ich: Ja, das war sehr klug. Aber ehrlich gesagt war diese Entscheidung gar nicht so bewusst.
Therapie ist wie Tanzen.
Gibt es eine übergeordnete Philosophie, der Sie in Ihrer Arbeit folgen?
Therapie ist wie Tanzen. Im Film „Dirty Dancing“ gibt es doch die bekannte Szene, in der Johnny seiner Tanzpartnerin Baby erklärt: „Das ist mein Tanzabstand, das ist dein Tanzabstand.“ Das finde ich ein schönes Bild, um zu erklären, wie man die therapeutische Beziehung gestalten sollte: Man ist aufeinander bezogen, und es gibt eine große Nähe, die aber trotzdem ein Stück Distanz enthalten muss, sonst stolpert man über die Füße des anderen. Diese Beziehung, diesen Rahmen benötigt man für alles Weitere.
Als nächstes muss man sich dann darauf einigen, welchen Tanz man miteinander tanzen möchte: eher eine fröhliche Samba, eine dramatische Rumba oder vielleicht doch lieber einen eleganten Walzer? Man legt also Ziele fest.
Um bei dieser Analogie zu bleiben: Im Paartanz gibt es die etwas archaisch anmutende Unterscheidung, dass der Mann führt und die Frau folgt. Auf die Therapie übertragen heißt das, dass es meine Aufgabe als Therapeutin ist zu führen, also an bestimmten Stellen einen Impuls zu setzen, zu intervenieren in der Hoffnung, dass die oder der andere die Impulse aufgreifen und in eine Bewegung umsetzen kann.
Und natürlich passiert es dabei auch ab und an, dass ich meiner Meinung nach gekonnt und ausgeklügelt Impulse setzte, doch mein Gegenüber bewegt sich einfach nicht. Frechheit! Dann sind wir Therapeut:innen schnell beim Konzept „Widerstand“. Ich finde, wir machen es uns da manchmal leicht und gehen davon aus, dass es, wenn ein Impuls nicht umgesetzt wird, am Gegenüber liegt: Der will eigentlich gar nicht tanzen, ist motorisch unbegabt, hat zwei linke Füße. Das sind sicher mögliche Gründe, ich finde es aber auch wichtig, sich selbst zu hinterfragen: Vielleicht habe ich den Impuls an der falschen Stelle gesetzt oder war zu schnell. Hier geht es um ein Gespür für Takt und Timing und um den beharrlichen Glauben daran: Jeder kann tanzen!

… will es aber vielleicht nicht.
Ja, manchmal stellt man auch fest: Der andere hat sich zwar zum Tanzkurs angemeldet, möchte aber eigentlich lieber Tischtennis spielen. Psychotherapie ist nicht für jede und jeden ein in gleicher Art und Weise geeignetes Behandlungsverfahren.
In der Paarberatung arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen. Was sind die Vorteile?
Diese Konstellation wird von den Paaren sehr geschätzt. Wenn lediglich ein Berater ein Paar begleitet, ist es manchmal gar nicht so leicht, objektiv und außen vor zu bleiben. In der Beratung zu viert gibt es nicht so schnell das Gefühl, dass sich Allianzen herausbilden. Und natürlich schätze ich die Tatsache, dass man das Vorgehen mit jemandem abstimmen kann.
Mich begeistert, dass einfach immer was geht; man muss nur bereit sein, die Abstraktionsebene zu verändern, die kleinen Bewegungen spüren und schätzen lernen.
Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit? Was sind besonders schöne Momente?
Zunächst einmal schätze ich es sehr, dass ich Zeit für meine Patient:innen habe. Ich empfinde es als unglaublichen Luxus, 50 Minuten lang mit jemanden in Ruhe, ohne Störfaktoren sprechen zu können. Und klar, es gibt manchmal große Momente am Ende von Therapien, wenn sich Erfolge deutlich zeigen. Für mich sind es aber auch besondere Augenblicke, wenn ich Mikroprozesse beobachte: dass es etwa jemandem gelingt, sich mal in den Sessel zu fläzen oder plötzlich Blickkontakt zu halten. Mich begeistert, dass einfach immer was geht; man muss nur bereit sein, die Abstraktionsebene zu verändern, die kleinen Bewegungen spüren und schätzen lernen.
In welchen Situationen fällt Ihnen Ihre Arbeit schwer?
Natürlich gibt es Frustrationen. Aber ich erlebe das meist eher als Herausforderung, als Anstoß, mich zu fragen: Warum nervt mich das gerade so? Warum ärgert mich das? Das ist Teil dieses Jobs, und ich finde das sehr spannend.
Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Praxis eingerichtet? Was war Ihnen besonders wichtig?
Bei den Räumlichkeiten haben wir uns eher von unserer Intuition leiten lassen. Wir haben uns, bevor wir uns 2011 hier niederließen, viele Räume angeschaut. Hier haben wir beide gesagt: Das fühlt sich richtig an, hier bleiben wir. Wir waren uns da sofort einig.
Und ja, auch die Einrichtung ist ein wichtiges Thema. Ich schätze zum Beispiel meine Sessel, weil sie sehr bequem sind und zu verschiedenen Sitzhaltungen einladen. Es ist spannend zu beobachten, wie Patient:innen sich diese Sessel „erarbeiten“. Manche machen es sich sofort bequem, andere lehnen sich erst im Verlauf der Therapie das erste Mal an.
Worauf könnten Sie in Ihrer Praxis auf keinen Fall verzichten?
Unsere Espressomaschine.
Ehrlich?
Ja. Während meiner Ausbildung durfte ich ein Tutorium bei einem sehr erfahrenen Therapeuten besuchen. Und der sagte einmal: Sie schaffen diese Ausbildung nicht, wenn Sie nicht schon heute visualisieren, wie die Couch in Ihrer Praxis aussehen soll. Das hat mich inspiriert, ich habe gedacht: Wenn ich mal eine Praxis habe, dann brauche ich da auf jeden Fall guten Kaffee. Und da traf es sich gut, dass ich einen Kollegen fand, der nicht nur wirksame Therapien, sondern auch wirksamen Espresso machen kann.

Und dann haben Sie zusammen das sehr erfolgreiche „Repetitorium“ geschrieben. Wie kam es zu dieser Idee?
Kai und ich hatten glücklicherweise beide kurz nach unserer Approbation die Möglichkeit, an unserem Ausbildungsinstitut, der Berliner Akademie für Psychotherapie, in die Lehre einzusteigen. Durch die Seminare zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung sammelten wir Erfahrungen, wie man diese Unmenge an Stoff und das zum Teil sehr trockene Wissen strukturiert aufarbeiten und gut vermitteln kann. Gemeinsam kamen wir dann auf die Idee, daraus ein Buch zu machen.
Haben sie damit gerechnet, dass das so einschlägt?
Überhaupt nicht, nein.
Wie hat sich Ihr berufliches Leben seitdem verändert?
Da hat sich nicht viel verändert. Wir behandeln Patient:innen, begleiten Supervisand:innen und geben Seminare. Und: Ich habe immer noch keinen Privatparkplatz in Berlin Mitte. Aber wir verdanken dem Buch eine ständige Aktualisierung unseres Wissens, auch durch den Austausch mit Prüflingen. Das ist toll. Und Sie fragten vorhin ja nach schönen Momenten: E-Mails von frisch approbierten Therapeut:innen, die sich unbekannterweise bedanken – das ist auch wirklich schön.















