"Je klarer das Angebot, desto eher reagieren die Klient:innen" – Interview mit Petra Jagow

Machst du als Coach einen guten Eindruck? Und wie werden deine Klienten überhaupt auf dich aufmerksam? Das und vieles mehr sind klassische Fragen des Marketings. Worauf man noch achten sollte, verrät dir Wirtschaftspsychologin und Coach Petra Jagow, die in Seminaren ihre Klienten regelmäßig dabei unterstützt, ihr Angebot zu schärfen und sich auf dem Markt zu behaupten.
„Der erste Eindruck zählt“ – was kann man als Coach tun, um einen guten ersten Eindruck zu machen?
Sympathisch und kompetent wirken. Die Optik ist das erste, was man wahrnimmt, daher macht man das am besten mit einem guten Outfit, sympathischem Lächeln und Entschiedenheit im Blick.

Wie findet man da eine gute Mischung aus „kompetent wirken“ und „man selber sein“?
Das, was wir als Coaches und Berater anbieten, findet immer in einem Übertragungsverhältnis statt – entweder es passt oder es passt nicht. Je prägnanter mein Angebot ist, desto eher reagieren die passenden Klienten auf mich. Je mehr man bei sich ist, desto eher kann das funktionieren mit dem match.
Also ist beides wichtig?
Genau. Wichtig ist, dass man etwas Freundliches ausdrückt. Im Foto ist es das leichte Lächeln. Wichtig ist dabei, dass man einem Coach in die Augen sehen kann. Wir haben viele Kollegen mit Brille und wenn die Brille davor rutscht, wirkt das eher unnahbar.
Ich habe eine neue Klientin, die über Google gekommen ist. Sie hatte auf meiner Website gestöbert und sagte dann: „da gab es Clips und so konnte ich mir das mit Ihnen gut vorstellen“. Das heißt, je mehr man im Vorfeld schon anbieten kann, desto leichter kann der Klient entscheiden, „mit der oder dem könnte das gehen“.
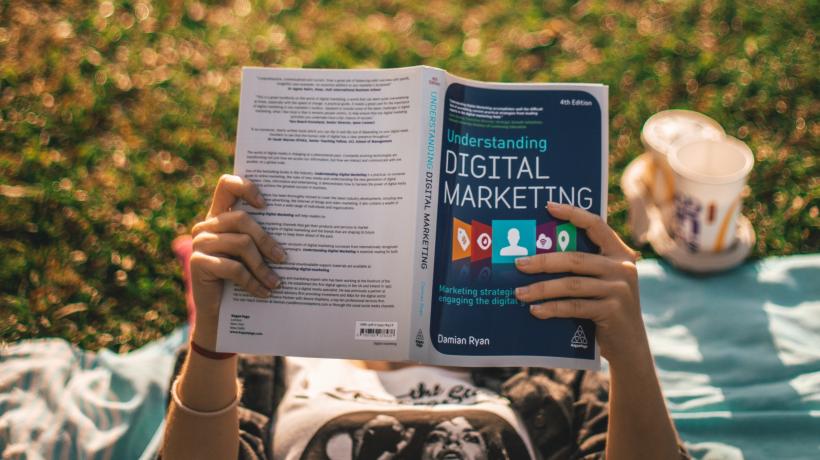
Wie sind Sie selbst vorgegangen, um Ihr Angebot zu schärfen und zu vermarkten?
Ich habe drei Marketingbücher gelesen. Was mir sehr eingeleuchtet hat, war die Anregung: Schau dir deine Lieblingsklienten an und wie du sie gewonnen hast. Wenn du davon mehr möchtest: Worauf sind die abgefahren? Was hat ihnen gefallen? Was hat sie bewogen, dich zu buchen?
Ich habe außerdem mit einer Designerin zusammengearbeitet, deren Sachen mir gefallen haben. Wir haben zusammen Namen, Logo, Website und den Stil entwickelt. Die typische Abfolge dafür im Branding: Was ist meine Vorstellung? Was sagen Kunden, aber auch Nicht-Kunden? Was ist das für ein Markt? Und wie tritt mein Wettbewerb auf? Das heißt, ich kann mir ganz viel angucken und kriege ein Gespür dafür, wie ich rüberkommen möchte. Man muss nicht alles neu erfinden.
Welche Rolle spielt denn da die Onlinepräsenz – ist das die Visitenkarte der heutigen Zeit?
Ja! Ich bin in Datenbanken repräsentiert, aber darüber kommt relativ selten jemand. Das ist wie eine weitere Visitenkarte, die einen fachlich verankert: „Sie ist in einer seriösen Datenbank, also kann ich mich darauf einlassen.“ Die eigene Website sagt, was man repräsentiert. Look and feel nennen wir das. Die potentiellen Klienten haben eine Empfehlung, gucken sich die Website an und wenn die ihnen gefällt, dann rufen sie an oder mailen. Jüngere Kundschaft kommt eher direkt über die Website. Es ist also gut, sie zu haben, sie muss aber auch gepflegt werden (Augenzwinkern).

Ich habe vor zwei Jahren umgestellt auf One Pager und Responsive, also der Stil, wie man auf dem Smartphone liest und, dass sich die Website jedem Medium schön anpasst. Das Smartphone ist eben das führende Medium. Das war nicht billig, wird aber sehr wertgeschätzt - das melden Klienten so zurück. In unseren Seminaren empfehlen wir deshalb, bewegte Clips auf der Website zu präsentieren. Die Jüngeren orientieren sich an Clips und Tutorials. Ein altmodisches Foto ist ein No-go, aber das sieht man noch sehr viel, genauso wie zu viel Text. Besser ist schlicht und klar ohne viel drum herum – wir kündigen schließlich keinen Blockbuster an, sondern eher einen Mehrteiler (lacht).
Sie unterstützen auch Kollegen bei der Entwicklung des eigenen Brandings. Was sind die typischen Herausforderungen?
Das ist ein Dreischritt: Beim Marketing ist die erste Überlegung: Wie tickt der Klient? Wenn Kollegen sagen, sie machen eine besondere Variante der systemischen Familientherapie, dann weiß die Kundschaft in der Regel nicht, wie sich das von anderen unterscheidet. Es ist für sie eher uninteressant. Für die Kundschaft ist wichtig: Was habe ich davon?
Der nächste Schritt ist, dass ich mein Angebot als Vorteil erzählen und begründen muss. Also: Was sucht meine Klientel? Daran muss ich anknüpfen und sagen: „Ich biete mit meinem Angebot folgende Vorteile und das können Sie mir glauben, weil...“.
Das ist klassisches Marketing, aber für die meisten Kollegen weit weg.
Warum ist das so?
Weil sie in ihrer Außendarstellung eher fachlich sind und nicht zu plakativ sein wollen. Alles muss ganz sauber erklärt sein. Viele Kollegen haben zudem Selbstzweifel: Kann man das so machen?
Im letzten Seminar hatten wir tolle Teilnehmer, aber egal in welchem Bereich sie gearbeitet haben war die Vorstellung immer nach demselben Schema: „Ich mache das und das ... das kann ich wirklich gut ... also ich meine, ich habe das schon gemacht“. Sie haben sich sofort wieder ein Stück zurückgenommen. Das würden BWLer und Ärzte nicht machen. In dem Zweifel „Bin ich gut genug?“ liegt die Schwierigkeit, wenn man sich vermarkten will.

Haben Sie eine Idee, warum gerade Coaches, Berater und Therapeuten so viele Selbstzweifel haben?
Das hängt eng damit zusammen, dass man andere unterstützen will und, dass wir uns in dieser professionellen Haltung eher zurücknehmen. Man hält sich als Person eher raus und ist oft abstinent. Das heißt, ein Teil der beruflichen Haltung ist, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Im Außenauftritt sind aber Person und Thema eins. Da dann zu switchen, das ist gar nicht so einfach.
Wenn ich das nicht kann, dann kann ich mir jemanden suchen, mit dem ich das zusammen mache, z.B. jemanden aus dem Design oder vom Marketing. Ich kann mich auch mit Kollegen zusammentun und man überlegt gemeinsam. Durch das Feedback von anderen kommt man sehr gut weiter: „Wird mir klarer, dass du Neuropsychologin bist, nur weil du ein Gehirn im Logo hast?“ Wenn 9 von 10 sagen „nee“, dann ist das ein wichtiges Feedback. Gut ist aber auch das Feedback von Fachfremden. Klienten sind ja keine Kollegen und für Klienten muss man oft noch mehr abrüsten. Es ist nie ein Fehler, die Botschaft einfach zu halten.
Was kann man konkret tun, um sich in Selbstdarstellung zu üben?
Es anderen zu erzählen, hilft, weil man dann merkt, an welchen Stellen man noch stolpert. In den Seminaren machen wir das mit einer Kamera – in zwei Durchläufen, damit man direkt sehen kann, wie man mit jedem Mal besser wird.
Ich kann mir vorstellen, dass da viele erstmal gehemmt sind.
Es geht. Wir haben manche, die sagen „hätte ich das genauer gelesen, wäre ich nicht gekommen“ – aber dann ist es zu spät (lacht). Bei größeren Gruppen machen wir es nach dem Prinzip „Freiwillige vor“.
Zunächst sollen die Teilnehmer Statements sagen: Wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein Angebot? Und als zweiten Schritt machen wir das in Interviewform. Meine Kollegin hinter der Kamera stellt Fragen, die die Teilnehmer beantworten.
Hinterher geben die anderen Teilnehmer konstruktives Feedback: „Das hat mich total überzeugt! Du hast mich sofort eingesammelt“ oder „Ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden, was du genau machst“.

Achten Sie neben den Inhalten auch auf Körperhaltung?
Wir achten immer auf Körpersprache – also grade Haltung, grader Blick, Lächeln, nicht herumschauen, nicht wippen und so weiter. Dann auf das Outfit – wie ist die Verpackung? Die Rhetorik – erkläre ich Fachwörter, nenne ich Beispiele, docke ich an Erfahrungen an, die das Gegenüber hat? Und die Dramaturgie. Die ist eigentlich am entscheidendsten! In dem Moment, wo jemand beginnt zu sprechen, habe ich mir schon ein Bild von der Optik und allem gemacht. Jetzt ist meine Aufmerksamkeit am höchsten. Das Wichtigste, was ich zu sagen habe, gehört direkt an den Anfang! Wer ich bin und was mein Titel ist, kann ich später noch sagen. Was auch immer mein Knaller ist, damit geht’s los! Wir nennen das den ‚umgekehrten Orgasmus‘, damit man sich das gut merken kann: der Höhepunkt kommt am Anfang (lacht). Das muss man üben, weil wir so nicht erzählen.
Gibt es auch „Dont’s“ beim Branding?
Ja, keine Spontanheilung und keine Glücksversprechen! Das ist nicht wirklich seriös. „Schnell“ versprechen viele, aber das stimmt eben nicht. Zu viel Selbstdarstellung schadet eher. Die meisten Kollegen sind ja eher schüchtern, aber wir haben auch ein paar „Rampensäue“ und die sind dann zu sehr mit sich und ihrer Inszenierung beschäftigt. Das bringt die Leute nicht weiter. Aber auch dafür findet sich Kundschaft, weil man sich mit dem Erfolg identifizieren kann.
Das Wichtige ist eben immer, ob die Beziehung passt oder nicht. Vor dem Psychotherapeutengesetz wurde in der Grawe-Untersuchung herausgearbeitet, was bei einer Therapie eigentlich wirkt. Platz eins: die vertrauensvolle Beziehung zwischen Behandler und Patient. Platz zwei: die Bereitschaft der Patienten, an sich zu arbeiten. Und an Platz drei kommt die Methode. Selbst die ist also nicht so entscheidend, wie das, ob es miteinander geht.



