„Jugendliche, die kiffen, fahren mit angezogener Handbremse“

Easy, gechillt und lustig: Cannabis wird bei Jugendlichen und jungen Erwachsener immer beliebter. Doch das jugendliche Gehirn ist viel vulnerabler für den Einfluss von Cannabis als das von Erwachsenen. Die Folgen: Antriebslosigkeit, Entfremdungserlebnisse und kognitive Einbußen. Welche Bausteine bei der Behandlung von Cannabisabhängigkeit eine Rolle spielen und wie er als Kinder- und Jugendpsychiater auf die Legalisierungsdebatten blickt, erzählt uns Frank Köhnlein im Interview.
Herr Köhnlein, Sie haben viele Jahre Erfahrungen in der Behandlung von Cannabisabhängigkeit. Ist der Konsum auch das Thema, mit dem die jungen Menschen zu Ihnen in Behandlung kommen oder stellen sie sich eigentlich wegen anderer Probleme vor?
Einer meiner ersten Patienten, als ich die Praxis eröffnet habe, ist tatsächlich in die Behandlung gekommen, weil er durch das Kiffen eine Depersonalisation erlebt hat - ein für ihn subjektiv völlig beängstigendes Erlebnis unter Cannabiskonsum. Aber in der Regel kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht, weil sie kiffen. Das ist eher ein sekundäres oder tertiäres Thema.
Das heißt, es wird im Verlauf der Behandlung zum Thema?
Genau. Wenn man beispielsweise auf Spurensuche geht, wie sich die Jugendlichen selbst behandeln oder helfen, kommt das Thema Cannabisgebrauch auf.
Was berichten Jugendliche, warum sie regelmäßig kiffen?
Die wenigsten kiffen für sich selbst, sondern in geselliger Runde. Sie sagen, das ist dann einfach easy, gechillt und lustig. Sie kiffen, weil die anderen auch kiffen. Wenn man nachfragt: „Was würde passieren, wenn du nicht kiffst und die anderen schon?“, dann kommen so Aussagen wie: „Dann wäre ich abgehängt. Das wäre doof, wenn die anderen es lustig haben und ich sitze einfach da“. Wenn du ein bisschen tiefer fragst, kommt irgendwann: „Ich kiffe auch, damit ich abschalten kann“, z. B. von den Problemen, die sie in Schule, Lehre oder Beziehung haben. Aber das kommt oft erst als sekundäre Begründung oder im Verlauf der Therapie, wenn sie schon etwas länger in Behandlung sind.
Welche Nebenwirkungen und Folgen können durch (regelmäßigen) Cannabiskonsum auftreten?
Was einem in der Praxis wirklich häufig begegnet ist, dass die Jugendlichen keine Lust und keinen Bock mehr haben. „Alles ist egal.“ Sie werden antriebslos. Ich hatte heute früh noch einen Patienten da, der es jetzt geschafft hat, 2 ½ Monate abstinent zu sein. Der hat gesagt, die Devise im letzten Jahr sei gewesen: „Ich mag nicht…“. Aber das sei jetzt weg, dieses Ausgebremste, Verzögerte, Verlangsamte.
Die heftigeren Reaktionen, die einem in der Praxis begegnen, sind depressive Störungen und pseudo-psychotische Phänomene. Nicht unbedingt nur die Psychosen, die wir im Hinterkopf haben sollten, sondern Entfremdungserleben, die bizarr und beängstigend sind. Ein Jugendlicher beschrieb mir mal, er fühle sich, als würde er in einer riesigen Kugel durch die Straße laufen und manchmal passe er gar nicht durch die kleinen Straßen. Solche Erlebensweisen sind dann auch irgendwann nicht mehr lustig.
Wenn Jugendliche abstinent werden, wie lange dauert es in etwa, bis solche Nebenwirkungen wieder verschwinden und sich das Erleben normalisiert?
Da gibt es keine Faustregel, aber wahrscheinlich einen nicht-linearen Zusammenhang mit der Dauer und dem Beginn des Konsums. Meine klinische Beobachtung ist: Wenn jemand schon seit dem 14. Lebensjahr kifft und mit Anfang 20 erst aufhört, wie mein Patient heute morgen, dauert die Erholungszeit viel länger. Soweit wir es bisher verstehen, spielt auch die Genetik eine Rolle, wie schnell sich das Gehirn von der kognitiven Ausbremsung erholt. Der Patient hat zum Beispiel beschrieben, sein Körper sei wieder fit, aber das Gehirn sei noch müde. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das in 4-6 Monaten anders sein wird.
Nach kurzer Zeit von Abstinenz berichten Jugendliche schon, dass sich ihr Wortschatz wieder erweitert. Sie können wenig damit anfangen, wenn man ihnen sagt: „Du hast Einspeicherstörungen“. Aber wenn du sagst: „Guck mal deinen Wortschatz unter Cannabis an und dann kiff mal eine Woche nicht“ – das ist schon beeindruckend. Sie merken, sie haben vorher keinen gescheiten Satz hingekriegt und können auf einmal wieder reden. Viele sagen dann: „Ich bin ja richtig dumm geworden mit Cannabis“. Das stimmt natürlich nicht, du verlierst ja keine Intelligenz. Aber du verlierst die Sprache, die Speicherfähigkeit und die Konzentration.
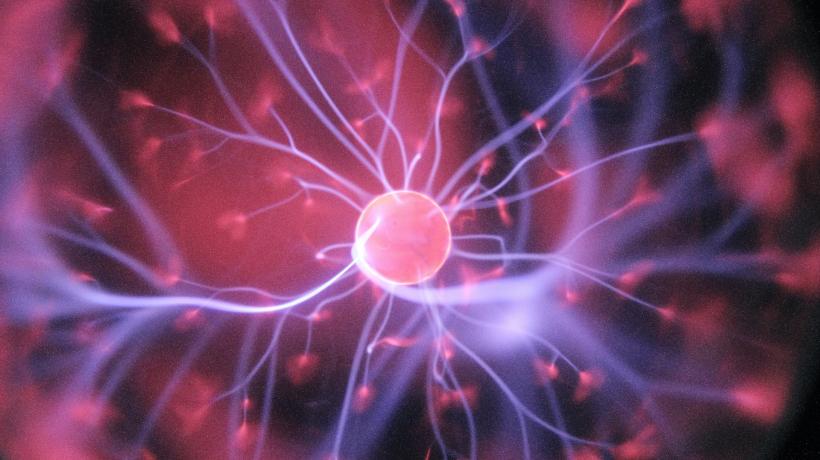
Sie raten dazu, bis zum 25. Lebensjahr gar nicht zu kiffen. Warum genau diese Altersgrenze?
Sie können auch 22 oder 27 Jahre nehmen. Man kann eben nicht genau sagen, wann ein Gehirn fertig ausgereift ist. Klar ist, dass es mit 18 Jahren noch nicht fertig ist! Das 18. Lebensjahr ist eine soziologische und rechtliche Grenze, aber mit 18 ist man noch nicht vollständig erwachsen. So erleben sich auch die jungen Erwachsenen oft selbst nicht.
Dem jungen Mann heute morgen habe ich gesagt: „Was ich nicht verstehe an der ganzen Cannabissucht, wie kann man denn, wenn es grade bergauf geht, die Handbremse anziehen?“ Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Wenn du im Erwachsenenalter bist, in einem Steadystate, dann bist du gesettelt, dann musst du nicht mehr kämpfen oder bergauf leben. Aber im Jugendalter musst du bergauf leben, du musst laufend Prüfungen machen, dich beweisen, dich durchsetzen, dich sexuell identifizieren, Partner finden, whatever – das ist ja ein kompletter Wahnsinn! Dieser Wahnsinn passiert den jungen Menschen, die noch fresh sind und die das eigentlich können. Wie kann man denn dann sagen: „Ja, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, die Handbremse anziehen“? Das ist für mich widersinnig - und das sehen Jugendliche auch ein. Ich mache schon deutlich: Jetzt ist die Phase, in der du deine Maschine da oben brauchst, mit maximaler Performance, in der geistigen Höchstfähigkeit. Das jugendliche Gehirn ist einfach viel vulnerabler als das erwachsene Gehirn!
Welche Auswirkungen hat Cannabis auf die Gehirnreifung?
Die Myelinisierung, also dass die Nerven mit Markscheiden umgeben werden, findet in der Säuglingszeit und Kindheit statt, wird aber in der Pubertät noch einmal stark differenziert. Das ist ein sensibler Prozess. Im Gehirn wird konstant geschaut: Welche Leitungsbahnen sind wichtig? Welche brauche ich? Welche muss ich zu Autobahnen ausbauen? Welche können Bundesstraßen oder Landstraßen bleiben und welche brauche ich gar nicht mehr? Dieser Prozess wird erschwert oder – das weiß man heute noch nicht so genau – vielleicht sogar irreversibel verhindert. Wenn ich mir dann vorstelle, ich habe Schwerlastverkehr, den kann ich nicht über eine Bundesstraße und schon gar nicht über eine Landstraße jagen. D. h. ich kann das nachher nicht so nutzen, wie ich es brauche.
Man weiß auch, dass es offensichtlich Veränderungen in der Amygdala gibt. In diesem Teil des Gehirns haben es sich bei uns allen die Angst und die Panik gemütlich gemacht. Da ist es schon naheliegend, dass die Entwicklung von Angststörungen bei Cannabiskonsumenten um ein Mehrfaches erhöht ist. Das gleiche gilt für den Hypothalamus. Den brauchen wir, um alles, was auf uns einströmt, zu filtern und in Aktion umzuwandeln. Wenn ich das zentrale Steuerorgan flachlege, dann geht das nicht mehr. Und schließlich der kleine Hippocampus, der so wichtig für das Lernen und für das Erinnern ist – auch da haut das Cannabis direkt rein. Die Folgen davon... habe ich vergessen (lacht).
Im Moment müssen wir davon ausgehen, dass Cannabis toxischer ist, als wir das früher geglaubt haben. Das hat auch meine Haltung gegenüber Cannabis in den letzten Jahren entscheidend verändert.
Viele Jugendliche, mit denen ich über Cannabiskonsum spreche, sagen so etwas wie: „Aber Alkohol ist viel schlimmer… und das trinkt jeder“. Was sagen Sie in solchen Fällen?
Ich habe da eine total unpassende Standardantwort: „Ach, Beinbruch ist viel schlimmer… dann breche ich mir lieber den Arm“. Das ist ja, als müsste man zwischen zwei Übeln entscheiden. Natürlich ist Alkoholkonsum schädlich, hoch toxisch und eine veritable Gesundheitsgefahr. Aber punktueller Alkoholkonsum ist womöglich weniger schädlich für einen Jugendlichen als punktueller Cannabiskonsum. Das wissen wir eben noch nicht so genau. Alkohol kennt die Gesellschaft seit etwa 5000 Jahren und erforscht ihn wahrscheinlich seit etwa 150 Jahren. Zu Cannabis gibt es vergleichsweise kaum Forschung. Da haben wir noch ein bisschen Rückstand. Ich bin überzeugt, dass man in 20 Jahren mehr darüber wissen wird, was im Gehirn abgeht, wenn man kifft.
Kann eine Therapie begonnen werden, solange der/die Jugendliche regelmäßig kifft?
Man kann und muss mit diesen Jugendlichen arbeiten. Aber Cannabiskonsum kann ein Therapiehindernis sein. Schon rein praktisch: Ich habe z. B. eine Patientin, die cannabisabhängig ist und es einfach nicht schafft, zu den Terminen zu kommen, weil sie die verpeilt. Eine andere Patientin, die den dringenden Wunsch hat, traumatherapeutisch zu arbeiten, kann das ich nicht anfangen, solange sie immer den Rückzug in die Sucht wählt, wenn’s schwierig wird. Dann wird sie sich mit dem Trauma nicht auseinandersetzen können. Man muss also manchmal zuerst diesen großen Fels aus dem Weg räumen, bevor man weitergucken kann.

Welche therapeutischen Bausteine spielen in der Behandlung von Cannabisabhängigkeit eine Rolle?
Wenn man sich an den Stadien der Veränderung orientiert, zeigt das eigentlich, wo man in der Therapie lang muss. Die Jugendlichen kommen in aller Regel erst mal gar nicht wegen ihres Cannabiskonsums, sondern sie erwähnen das nebenbei. Da ist noch null Problembewusstsein da! Vielleicht kommen sie aber schon mit einem ersten Gedanken, irgendwas läuft da nicht mehr so richtig. Das wäre dann schon die zweite Stufe, aber noch ganz diffus, ohne Handlungsplanung oder Veränderungsabsicht. Der nächste Schritt in der Therapie wäre: Gibt es denn einen Veränderungsimpuls? Wer will, dass du dein Verhalten veränderst? Gemeinhin muss man darauf hinarbeiten, dass dieser Veränderungsimpuls intrinsisch wird: „Ich will es!“ Welche guten Argumente gäbe es für dich, etwas zu verändern? Das können finanzielle Gründe sein, das können kognitive Gründe sein… die gilt es herauszuarbeiten. Das nächste wäre dann zu überlegen: Wie könnte man diese Veränderung erreichen? Welche ist realistisch? Wie aussichtsreich ist diese Veränderung? Lass uns das mal in Gedanken durchspielen: Wie wäre es denn, wenn du jetzt nicht mehr kiffen würdest, einen Tag lang oder eine Woche? Wie würden deine Freunde reagieren, wenn alle kiffen und du nicht?
Danach geht es darum, den Impuls in die Tat umzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. Unter Umständen müssen wir dann wieder ein Stück zurück und schauen: Was hat nicht geklappt? War das Ziel zu weit gesteckt? Was kann man weiterplanen, erneut ausprobieren? usw. Vielleicht kommt es zu einem Relaps. Vielleicht merkt die Person aber auch, dass es mehr Positives hat, wenn er oder sie darauf verzichtet. Wenn das so ist, geht es um die Aufrechterhaltung. Die Suchtbehandlung fängt aber immer im Kopf an. Die Patient:innen können nicht starten, wenn es nicht vorher durchgedacht ist.
Geht es immer um das Erreichen einer Abstinenz?
Früher habe ich gesagt, nein – und vielleicht sehe ich das irgendwann auch wieder moderater. Aber im Moment sage ich: Ja, es geht um Abstinenz. Und wer mir recht gibt, ist mein Patient von heute morgen. Den habe ich gefragt: „Jetzt sind Sie 2 ½ Monate abstinent, was wäre, wenn Sie jetzt wieder kiffen würden?“ Und er sagt: „Ich glaube, das würde mich genauso wieder reinziehen wie einen Alkoholkranken.“
Ich kann es schlecht beurteilen. Man sagt ja gemeinhin, dass Cannabis nicht so suchterzeugend ist, weil es nicht so stark körperlich abhängig macht. Aber die psychische Abhängigkeit sollte nicht unterschätzt werden – gerade, wenn man eine Zeitlang abstinent war und das Cannabis wieder besonders gut flasht. Dann wieder „nein“ zu sagen, braucht schon sehr viel Macht des Verstands über das Gefühl. Aber klar, es gibt wahrscheinlich weitaus schlimmeres, als wenn ein Jugendlicher seine Schule hinbekommt, Hobbies hat, Freundschaften führt, aber am Wochenende mal kifft. Aber im Allgemeinen würde ich schon dazu raten, es auszuprobieren, ob man das Leben nicht ganz ohne die Substanz gestalten kann.

Wie blicken Sie als Psychiater auf die aktuellen Legalisierungsdebatten?
Spannend ist, dass wir die in der Schweiz auch haben, aber die Legalisierung hier anders vor sich geht. Aktuell läuft hier in Basel ein Pilotprojekt, wo das Cannabis in Apotheken bezogen werden kann und das wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird. Rund 300 Personen nehmen teil. Junge Erwachsene hat man explizit rausgenommen, weil man eben nicht weiß, was im Gehirn von Anfang 20-jährigen passiert.
In Deutschland scheint die Diskussion etwas anders zu laufen. Ich halte es für gefährlich, dass 18- oder 19-jährige legal Cannabis beziehen können. Man könnte natürlich sagen: „Gut, die würden das sonst sowieso auf der Straße beziehen“ und man kann nur hoffen, dass sie auf diesem Weg zumindest nicht so viele synthetische Cannabinoide abkriegen. Aber ich halte es dennoch für ein falsches Signal. Erwachsene sind da in einer anderen Position, für sich Entscheidungen zu treffen. Aber bei Jugendlichen hat die Gesellschaft vor dem Hintergrund der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse schon eine andere Schutzaufgabe.
Ist davon auszugehen, dass der Konsum von Cannabis bei Jugendlichen durch die Legalisierung noch weiter zunimmt?
In Ländern, in denen die Cannabislegalisierung schon durchgeführt wurde, ist der Konsum vorübergehend angestiegen und hat sich dann wieder eingependelt. Aber der Konsum an sich nimmt auch ohne Legalisierung kontinuierlich zu.
Was brauchen Jugendliche vielleicht noch präventiv an Aufklärung, Infos und Begleitung?
Es fließt viel Geld in Prävention – und das ist gut. Aber es wird etwas wenig dafür geworben, wie geil das Leben ohne Cannabis ist, wie super das ist, wenn der Wortschatz drei Mal so groß ist, wenn man die Schule hinkriegt, usw. Man könnte sagen: „Du hast so ein super Gehirn, nutze es! Deine Zukunft liegt vor dir, verrauch sie dir nicht!“ Aber ich bin kein Präventionsexperte. Prävention ist oft schnell so „zeigefingerig“. Und ich bin wahrscheinlich auch die meiste Zeit zeigefingerig unterwegs (lacht).
Wie finden die Jugendlichen bei Ihnen in der Behandlung den Zeigefinger?
Die kennen das von mir. Aber die meisten mögen mich halt irgendwie und wenn ich sowas sag, dann macht das schon was mit ihnen, auch wenn’s im ersten Moment etwas boomermäßig oder schulmeisterlich daherkommt. Wir lassen uns ja gemeinhin am ehesten von Gründen überzeugen, die uns selber in den Sinn gekommen sind. Daher ist es so wichtig, dass die Jugendlichen selbst gute Gründe finden. Sie sollen nicht für die Gesellschaft oder die Schule und auch nicht für den Psychiater mit dem Kiffen aufhören, sondern ganz individuell: „Welche guten Gründe gibt es für mich, mein Verhalten zu ändern?“
Vielen Dank für das Interview!
Über Frank Köhnlein:
Dr. med. Frank Köhnlein ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Er war 16 Jahre lang Oberarzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik Basel und ist seit 2018 in eigener Praxis tätig. Daneben arbeitet er als Hochschuldozent, Supervisor, Fachberater für Behörden - und schreibt humorvolle und informative Romane über die Kinder- und Jugendpsychiatrie: Seine Bücher „Vollopfer“ (2013), „Kreisverkehr“ (2015) und „Krankmachen“ (2022) finden eine breite mediale Aufmerksamkeit.




