Einsamkeit begegnen, bevor sie krank macht

Einsamkeit betrifft Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten und hat erhebliche Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit. Im Interview erläutert Prof. Dr. Susanne Bücker, Professorin für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Witten/Herdecke, wie verbreitet Einsamkeitserleben ist und wie die Corona-Pandemie das Problem insbesondere für junge Menschen verschärft hat. Zudem erklärt sie, wie Einsamkeit in Therapie und Beratung, aber auch gesellschaftlich begegnet werden kann.
Wie definieren Sie Einsamkeit, und wie lässt sie sich abgrenzen von verwandten Konstrukten?
Einsamkeit beschreibt eine Diskrepanz zwischen den gewünschten und den vorhandenen sozialen Beziehungen. Wichtig ist, dass es sich dabei um eine subjektive Wahrnehmung handelt. Menschen können trotz objektiv vieler Kontakte unzufrieden mit ihren sozialen Beziehungen sein, wenn sie diese als oberflächlich oder unpassend erleben.
Im Gegensatz dazu geht es beim Alleinsein oder sozialer Isolation um objektive Zustände: Mit wie vielen Menschen leben wir zusammen bzw. haben wir Kontakt? Obwohl soziale Isolation mit Einsamkeit einhergeht, sind die Korrelationen interessanterweise nicht stark. Bei Weitem nicht alle Menschen, die sozial isoliert leben, fühlen sich einsam, insbesondere wenn sie diesen Zustand selbst gewählt haben.
Bei der Jahrestagung 2024 des Deutschen Ethikrats betonten mehrere Sprecher:innen, dass Einsamkeit nicht zugenommen habe. Wie kommt es, dass dennoch häufig dieser Eindruck entsteht bzw. sogar von einer „Einsamkeitsepidemie“ die Rede ist?
Die von Ihnen beschriebene Position wurde vor allem von Forscher:innen vertreten, die nicht empirisch arbeiten. In den empirisch arbeitenden Wissenschaften gibt es durchaus Evidenz für Anstiege in der Einsamkeit. So fühlen sich junge und mittelalte Erwachsene heute etwas einsamer als Kohorten vor 30 oder 40 Jahren. Diese Anstiege sind allerdings nicht so groß, dass Begriffe wie „Einsamkeitsepidemie“ angemessen wären. Hochaltrige Menschen sind heute sogar etwas weniger einsam als frühere Kohorten, was vor allem Verbesserungen im Gesundheitssystem zu verdanken ist, die ein längeres Leben im häuslichen Umfeld möglich machen.
Einen auffälligen Ausreißer bildet die Corona-Pandemie. Durch die Lockdowns und die sozialen Einschränkungen kam es zu einem deutlichen Anstieg der Einsamkeitszahlen, der sich bis heute nicht vollständig normalisiert hat. Auch 2024 sind die Werte noch höher als 2017, vor allem bei jungen Menschen.
Wie kann das sein?
Vermutlich sind es multikausale Entwicklungen, die sich leider schwer empirisch prüfen lassen. Es gibt theoretische Überlegungen zu parallelen Veränderungen in Werten und Normen in den westlichen Kulturen, etwa eine Entwicklung hin zu neoliberalen Werten und höheren Anforderungen an Individuen. So könnte sich z. B. Wettbewerbsdruck unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen negativ auf die Beziehungsgestaltung auswirken. Diskutiert werden bei jüngeren Menschen zudem digitale Medien, wobei nur bestimmte Arten der Mediennutzung negative Effekte auf soziale Beziehungen haben.

Sind denn vor allem junge Menschen betroffen?
Ja, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab es während der Pandemie deutlich größere Anstiege in der Einsamkeit als im mittleren oder hohen Alter. Das wird oft damit begründet, dass in dieser Lebensphase breite soziale Netzwerke mit Gleichaltrigen wesentlich sind. Aber genau diese konnten durch Kontakteinschränkungen und Schulschließungen nicht gepflegt werden.
Dass sich diese Personen auch heute, fast zwei Jahre nach den Lockdowns, immer noch einsamer fühlen, wirft die Frage auf, ob die Einschränkungen sie eventuell in bestimmten, besonders sensiblen Entwicklungsphasen erwischten – ähnlich denen, die wir aus der Entwicklungspsychologie, z. B. für den Spracherwerb im Kleinkindalter, kennen. Für Jugendliche ist Identitätsentwicklung eine entscheidende Entwicklungsaufgabe. Wenn sie nun ihre sozialen Beziehungen nicht so ausgestalten können, wie sie das bräuchten, lässt sich das eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr vollständig aufholen, was zum beobachteten verschleppten Effekt der Pandemie führen könnte. Da gibt es nach wie vor viele offene Forschungsfragen.
Das betrifft auch Kinder und jüngere Jugendliche, bei denen wir leider mit Bezug auf Einsamkeit noch sehr wenig wissen. Diese Forschungslücke wollen wir in einem aktuellen Projekt mit Kindern ab sechs Jahren und deren Eltern schließen. Dabei geht es uns um das Einsamkeitserleben, aber auch um Regulationsmechanismen: Was tun Kinder, wenn sie sich so fühlen?
Wie viele Menschen in Deutschland sind chronisch einsam? Wer ist besonders betroffen?
Über alle Altersgruppen und sozioökonomischen Schichten hinweg fühlen sich etwa 10 % der Bevölkerung chronisch einsam, wobei die Zahlen schwanken, je nachdem, ob nach Intensität oder Häufigkeit der Einsamkeitsgefühle gefragt wird. Wenn wir alle dazuzählen, die sich „manchmal einsam“ fühlen, sind es noch sehr viel mehr Menschen. Während der Pandemie waren es fast 40 %.
Menschen mit niedrigem Einkommen, in Arbeitslosigkeit oder Armut berichten von mehr Einsamkeit als Personen in einer besseren finanziellen Situation. Auch das Bildungsniveau hängt mit dem Einsamkeitserleben zusammen, wobei neuere Arbeiten zeigen, dass der Effekt verschwindet, sobald man das Einkommen kontrolliert. Das scheint also der entscheidende Faktor zu sein.
Weitere wichtige Faktoren sind ein Migrationshintergrund und Ausgrenzungs- oder Diskriminierungserfahrungen, sei es aufgrund von Herkunft, Hautfarbe oder sexueller Orientierung. Ebenso berichten chronisch Kranke, pflegende Angehörige und Alleinerziehende von mehr Einsamkeit, Gruppen, denen vor allem die Zeit für befriedigende soziale Beziehungen fehlt.
Es gibt starke Zusammenhänge von Einsamkeit und psychischen Störungen. Was ist Ursache, was Folge?
In Längsschnittstudien zeigen sich oft wechselseitige Beziehungen: Personen, die zum ersten Messzeitpunkt einsamer sind, haben ein erhöhtes Risiko, später Symptome einer Depression, Angststörung oder Substanzabhängigkeit zu zeigen. Gleichzeitig berichten Menschen mit stärkeren psychischen Symptomen zu darauffolgenden Messzeitpunkten mit größerer Wahrscheinlichkeit von mehr Einsamkeit.
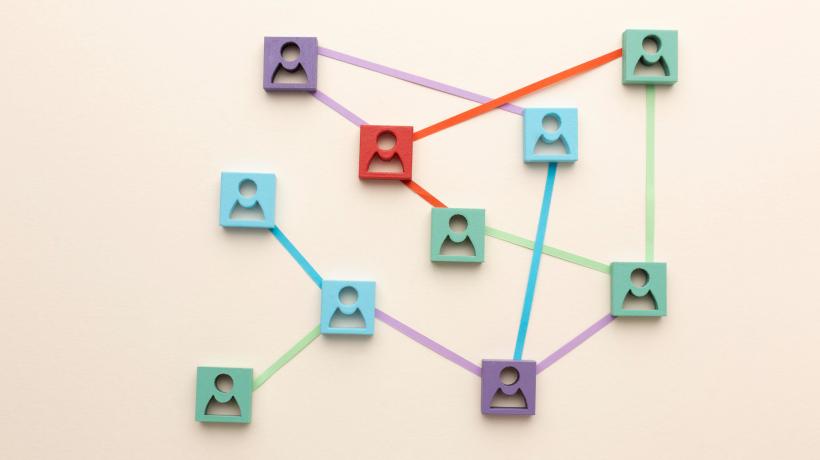
Ähnliche verhält es sich bei körperlichen Erkrankungen. Hier weisen vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen enge Verbindungen mit Einsamkeit auf. Menschen, die sich z. B. im mittleren Alter chronisch einsam fühlen, haben später ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzinsuffizienz und damit eine geringere Lebenserwartung. Zudem zeigen chronisch einsame Personen später mehr Demenz-Symptome.
Die Erklärungen für diese Zusammenhänge reichen von biochemischen Mechanismen bis zur Verhaltensebene. Zum einen ist Einsamkeit eine Art chronischer Stress, und die stärkere Cortisolausschüttung schädigt auf Dauer sensible Funktionen in Körper und Gehirn. Zum anderen geht es um Gesundheitsverhalten. Wer z. B. aufgrund von Einsamkeit viel Alkohol konsumiert, erhöht sein Risiko für Demenz oder Herzerkrankungen.
In Anbetracht all dessen wäre es schön, Einsamkeit zu bekämpfen. Warum ist sie ein so schambehaftetes Thema, dass Menschen nicht darüber sprechen oder um Hilfe bitten?
Viele einsame Menschen machen sich selbst für ihre Einsamkeit verantwortlich, sehen es als persönliches Versagen an, es nicht geschafft zu haben, einen Freundeskreis aufzubauen oder jemanden an sich zu binden. Das schwächt das Selbstwertgefühl und führt zu weiterem Rückzug. Hinzu kommt: Wenn ich einer vertrauten Person mitteile, dass ich mich einsam fühle, könnte sich mein Gegenüber vor den Kopf gestoßen fühlen, im Sinne von: Heißt das, unsere Freundschaft reicht dir nicht? Das macht es in einem sozialen Gefüge schwer, über dieses Gefühl zu reden.
Betroffene würden Einsamkeit auch in Beratung oder Therapie eher nicht thematisieren. Wie lässt sich das Thema ansprechen, wenn man das Gefühl hat, eine Person bringt eine Einsamkeitsthematik mit?
Einsamkeit schwingt als Thema in vielen psychotherapeutischen Sitzungen mit, ohne explizit benannt zu werden, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Hat man den Eindruck, die Person wünscht sich mehr Kontakte oder enge Vertraute, kann man sie ihre Beziehungen in Beziehungskreisen visualisieren lassen. Im engsten Kreis fänden sich vielleicht Geschwister, Familienangehörige oder beste Freund:innen, im nächsten eventuell Arbeitskolleg:innen oder Kommiliton:innen und wieder im nächsten Nachbar:innen, weitläufige Bekannte.
Werden nur ganz wenige Personen genannt, könnte man in die Biografiearbeit gehen. War das schon immer so? Gab es Phasen, in denen die Beziehungen anders aussahen? Was hat sich verändert? Manchmal sind es Umzüge oder andere kritische Lebensereignisse, die zu Umbrüchen im sozialen Netz führen. So schafft man sich als Therapeut:in zunächst einen Überblick über frühere und aktuelle soziale Beziehungen der Person und zur Frage: Wünscht sich die Person bestimmte Menschen (wieder) näher an sich heran? Oder andere weiter weg? Es gibt ja auch nahe, aber destruktive Beziehungen …

Ein anderer Weg wäre es, über Emotionen allgemein zu sprechen. Gerade depressive Menschen haben z. B. oft Schwierigkeiten, unterschiedliche Emotionen zu differenzieren: Ist das Traurigkeit, Scham oder Einsamkeit? Klare Begriffe für das Erlebte zu finden, ist ein wichtiger erster Schritt.
Es scheint eine Art Negativspirale zu geben: Menschen, die sich einsam fühlen, verhalten sich in sozialen Kontexten anders und finden ihre Einsamkeit dadurch bestätigt. Wie kann das durchbrochen werden?
Zur gezielten Analyse von Alltagssituationen lässt sich das SORKC-Modell nutzen: Was ist die objektive Situationsbeschreibung? Und was meine Interpretation? Wie würde eine andere Person die Situation wahrnehmen? Welche anderen Erklärungen gibt es für das Verhalten des Gegenübers? Das hilft, alternative Perspektiven auf soziale Situationen zu erarbeiten und deutlich zu machen: Jede Wahrnehmung ist immer subjektiv eingefärbt.
Eine schöne Übung für Patient:innen ist es, den negativen Fokus auf soziale Situationen bewusst abzulegen und gezielt auf positive soziale Aspekte oder Interaktionen zu achten. Da chronisch Einsame zudem dazu tendieren, vor allem Unterschiedlichkeiten zwischen sich und anderen wahrzunehmen, können sie dazu animiert werden, in sozialen Situationen nach Ähnlichkeiten zu suchen, z. B. im Kleidungsstil, den Hobbys oder dem Wohnort. Eine ähnliche Übung besteht darin, wahrzunehmen: Welche andere Person ist mir sympathisch?
All diese Übungen funktionieren auch ohne jemanden direkt anzusprechen. Es geht vor allem darum, den Blick dafür zu schulen, dass es Gemeinsamkeiten gibt und dass andere Menschen keine Bedrohung darstellen.
Gibt es sinnvolle Interventionen auf gesellschaftlicher Ebene?
Erfolgreiche Ansätze umfassen immer Sensibilisierung und Entstigmatisierung, damit Menschen überhaupt den Raum bekommen, darüber zu sprechen – auch all jene, die das Gefühl haben, es stehe ihnen nicht zu, sich einsam zu fühlen, wie z. B. junge Eltern in den ersten Jahren mit Kindern.
In Großbritannien können Hausärzt:innen soziale Aktivitäten verschreiben („social prescribing“). Zudem gibt es sogenannte „link worker“, die hochaltrige Menschen mit sozialen Angeboten in Kontakt bringen. Ähnlich wirken z. B. in Rheinland-Pfalz die „Gemeindeschwestern“, Netzwerkpersonen in Gemeinden, die sich vor allem um ältere Menschen kümmern. So gut solche Projekte funktionieren, sie richten sich überwiegend an Hochaltrige. Jüngere Zielgruppen werden bisher leider kaum adressiert.
Was wünschen Sie sich für jüngere Menschen?
Auf jeden Fall sollten Jugendliche und junge Erwachsene mit Einsamkeitserfahrungen in die Entwicklung von Maßnahmen einbezogen werden, damit diese ihren Bedürfnissen entsprechen. Zudem würde ich mir wünschen, dass schon früh im Bildungskontext vermittelt würde, dass die Pflege von sozialen Beziehungen zum Gesundheitsverhalten gehört. Denn die Effekte sind ähnlich groß wie die von Sport oder gesunder Ernährung. Lehrkräfte sollten sich nicht nur als Wissensvermittler:innen verstehen, sondern auch als Menschen, die zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.
Auch Arbeitgeber:innen und überhaupt alle Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, müssten – ebenso wie politische Entscheidungsträger:innen – auf dem Schirm haben: Soziale Beziehungen sind nicht nur „nice to have“, sondern essenziell für gesundes Heranwachsen und Altern.
Vielen Dank für das Gespräch!
Über Prof. Dr. Susanne Bücker:
Prof. Dr. Susanne Bücker ist Professorin für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Witten/Herdecke. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung von Einsamkeit über die Lebensspanne sowie die Ursachen, Auslöser und Folgen von Einsamkeit. Sie war sachverständiges Mitglied in der Enquetekommission zu Einsamkeit des Landtags Nordrhein-Westfalen und berät regelmäßig politische Gremien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene zu Einsamkeit.

Zur Studienteilnahme:
Die Universität Witten/Herdecke sucht für ihre „Gefühlestudie“ Eltern von Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren. In einer Online-Befragung (ca. 30 Minuten) geht es um Fragen zu Gefühlen und Charakterzügen. Weitere Informationen: https://formr.uni-wh.de/gefuehle-studie




